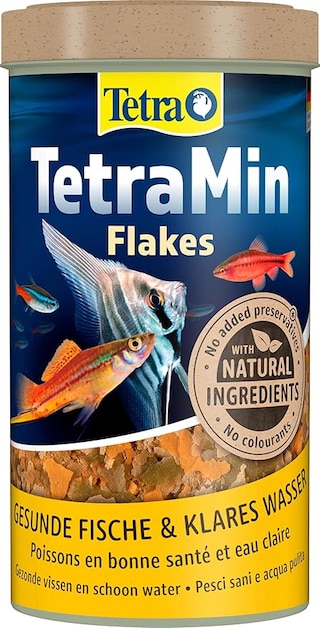3. Juli 2025, 17:34 Uhr | Lesezeit: 6 Minuten
Wale und Zungenküsse? Ja, dieses Verhalten gibt es wirklich. Bisher war es jedoch nur bei Orcas in Gefangenschaft bekannt. Nun wurde es erstmals in freier Wildbahn dokumentiert – und zwar unter Wasser: Zwei Schwertwale (Orcinus orca) zeigten ein auffällig zärtliches „Zungen-Knabbern“. Diese Beobachtung könnte das Verständnis über die sozialen Fähigkeiten und Bindungen dieser Meeressäuger grundlegend erweitern.
Küssen ist kein Verhalten, das nur uns Menschen vorbehalten ist. Auch Affen drücken ihre Münder aneinander, um sich zu „küssen“. Bisher ist wissenschaftlich bisher nicht abschließend geklärt, welche Ursprünge das Küssen hat. Eine Theorie besagt, dass es aus den Mund-zu-Mund-Füttern entstanden ist, andere vermuten, es hat sich aus dem Säugen an der Brust entwickelt. Zungenküsse gehen da noch mal einen Schritt weiter und wurden bisher nur bei Delfinen – darunter auch Orcas – beobachtet; allerdings in Gefangenschaft.
Sind „Zungenküsse“ Teil des natürlichen Verhaltens von Orcas?
Ein Forschungsteam unter der Leitung von Sánchez-Hernández von der Universität La Laguna hat im Fachjournal „Oceans“ erstmals eine sogenannte „tongue-nibbling“-Interaktion zwischen zwei wildlebenden Orcas beschrieben, die man auch als „Zungenküsse“ bezeichnen könnte. Die seltene Verhaltensweise wurde in den Kvænangen-Fjorden im Norden Norwegens aufgenommen und erfolgte im Rahmen einer Schnorchelexpedition von Bürgerwissenschaftlern. Die dabei entstandenen Videoaufnahmen liefern den bislang einzigen Beweis, dass diese soziale Interaktion auch unter natürlichen Bedingungen auftritt – und damit Teil des natürlichen Verhaltensrepertoires der Art sein könnte.1
Auch interessant: Warum Orcas die größten „Muttersöhnchen“ im Tierreich sind
Verhalten wurde erstmals 1978 erwähnt
Die Beobachtung von Sozialverhalten bei Walen stellt Forscher vor besondere Herausforderungen. Da sich viele Interaktionen unter Wasser abspielen, verlagert sich die Forschung zunehmend unter die Wasseroberfläche. Studien mit Delfinen und in Gefangenschaft gehaltenen Walen haben bereits komplexe Verhaltensmuster wie synchronisiertes Schwimmen oder gegenseitiges Körperstreicheln sichtbar gemacht.
Ein besonders auffälliges Beispiel ist das sogenannte „tongue-nibbling“ – das sanfte Knabbern an der ausgestreckten Zunge eines Artgenossen. Diese Interaktion wurde erstmals 1978 erwähnt und 2013 detailliert in einem Delfinarium dokumentiert. Sie galt bisher als ein potenziell durch Gefangenschaft ausgelöstes Verhalten. Mit der nun erfolgten Beobachtung in freier Wildbahn könnte sich dieses Bild ändern.
Keiner der befragten Experten hatte ein solches Verhalten bisher in freier Wildbahn direkt beobachtet
Am 11. Januar 2024 beobachteten und filmten Bürgerwissenschaftler in den Kvænangen-Fjorden in Nordnorwegen eine ungewöhnliche Interaktion zwischen zwei freilebenden Schwertwalen. Die Tiere näherten sich frontal, hielten für fast zwei Minuten anhaltenden Gesichtskontakt und führten drei separate Phasen sanfter Mund-zu-Mund-Interaktion aus. Die Szene wurde mit einer Unterwasserkamera aus einer Entfernung von etwa 10 bis 15 Metern gefilmt.
Die Analyse der Aufnahmen ergab eine starke Ähnlichkeit zum bereits bekannten „tongue-nibbling“, das in Delfinarien beschrieben worden war. Unterstützt wurde diese Deutung durch den Vergleich mit früheren Aufzeichnungen aus zoologischen Einrichtungen sowie durch Befragung erfahrener Taucher und Tierpfleger. Keiner der befragten Experten hatte ein solches Verhalten bisher in freier Wildbahn direkt beobachtet – was die Besonderheit dieser Dokumentation unterstreicht.
Die Beobachtungen der „Zungenküsse“ unter Orcas erfolgten unter kontrollierten und tierschutzkonformen Bedingungen. Die Schnorchelgruppe verhielt sich im Wasser passiv, um die Tiere nicht zu stören oder ihr Verhalten zu beeinflussen.
Beknabbern der Zunge könnte Teil eines angeborenen, sozialen Repertoires sein
Die Videoaufzeichnung aus Tverrfjorden dokumentiert mit einer Dauer von insgesamt einer Minute und 49 Sekunden erstmals das sogenannte „tongue-nibbling“-Verhalten zwischen zwei wildlebenden Orcas. Die Autoren verglichen die Aufnahme mit einem Video von 2013 aus Loro Parque (Spanien), in dem das Verhalten bei vier Schwertwalen unter menschlicher Obhut wiederholt dokumentiert wurde.
Die Interaktion entsprach nahezu exakt den bereits bekannten Verhaltensmustern aus Delfinarien, wo ein Tier die Zunge zeigt und das andere sanft daran knabbert. Dies stützt die Interpretation als soziales Verhalten. Aussagen von Tierpflegern bestätigen zudem, dass das Verhalten dort über mehrere Jahre bei Tieren unterschiedlicher Herkunft beobachtet wurde – darunter auch ein Tier aus Norwegen.
Die Relevanz der neuen Beobachtung liegt darin, dass damit erstmals belegt ist, dass das Verhalten nicht auf Gefangenschaft beschränkt ist, sondern auch in freier Wildbahn vorkommt. Damit ist es womöglich Teil eines angeborenen, sozialen Repertoires.
„Zungenküsse“ unter Orcas könnten dazu dienen, soziale Bindungen zu festigen
Die Studie liefert überzeugende Belege dafür, dass „Zungenküsse“ bzw. „tongue-nibbling“ ein natürliches, sozial motiviertes Verhalten bei Orcas darstellt – und nicht etwa eine Reaktion auf Gefangenschaft, Stress oder Langeweile. Die Ähnlichkeit der Verhaltenssequenz zwischen wilden und in Gefangenschaft lebenden Tieren lässt auf eine sogenannte konservierte soziale Funktion schließen. Das Verhalten hat also eine über Generationen hinweg stabile Bedeutung innerhalb der Art.
Dieses Verhalten könnte dazu dienen, soziale Bindungen zu festigen – insbesondere bei jüngeren Tieren, die noch nicht in Fortpflanzung oder Rangkämpfe eingebunden sind. Vergleichbare Interaktionen wurden auch bei Belugas beobachtet. Das stützt die Vermutung, dass oral-taktile Verhaltensweisen in der Familie der Zahnwale (Odontoceti) eine übergeordnete Rolle in der Sozialentwicklung spielen.
Zudem wird durch diese Beobachtung die ethologische Bedeutung von Tieren in menschlicher Obhut gestützt: Dort lassen sich seltene Verhaltensmuster unter kontrollierten Bedingungen dokumentieren und analysieren – und sie ermöglichen Rückschlüsse auf das natürliche Verhalten der Art. Die neue Studie bekräftigt daher die wissenschaftliche Relevanz zoologischer Einrichtungen, ohne dabei deren kontextuellen Unterschiede zur Wildnis zu vernachlässigen.
Aussagekraft der Studie begrenzt
Die Studie stellt eine Einzelfallbeobachtung dar und ist daher in ihrer Aussagekraft begrenzt. Die Interpretation basiert maßgeblich auf visuellen Parallelen zu bekannten Fällen unter menschlicher Obhut, wobei die Videoqualität keine feindetaillierte Analyse der Zungenbewegungen zuließ. Dennoch ist die Dauer und Struktur der Interaktion ausreichend, um die Deutung als soziales Verhalten plausibel zu machen.
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht nicht, jedoch betonen die Autoren die Notwendigkeit, tiergestützte Tourismusaktivitäten streng zu regulieren. Zwar kann Citizen Science wertvolle Daten liefern, doch zu häufiger oder unkontrollierter Kontakt mit Wildtieren birgt Risiken: Verhaltensänderungen, Stress und Störungen sozialer Strukturen sind dokumentierte Nebenwirkungen solcher Begegnungen.
Die methodische Stärke der Studie liegt in der Integration von Unterwasserbeobachtungen und Vergleichsmaterial aus kontrollierten Haltungsbedingungen. Dennoch bleibt offen, wie verbreitet das Verhalten in Wildpopulationen tatsächlich ist – und unter welchen sozialen Bedingungen es bevorzugt gezeigt wird. Zukünftige Studien sollten systematische Unterwasserbeobachtungen nutzen, um weitere Daten zu sammeln.

Werkzeuggebrauch beim Wal-Wellness – auch Orcas nutzen Kelp zur Körperpflege

Studie zeigt erstmals, dass auch Wale Gesichtsausdrücke haben

Schimpansen benutzen Blätter, um sich den Po abzuwischen und nach dem Sex zu säubern
Fazit: „Zungenküsse“ scheinen bei Orcas die soziale Bindung zu stärken
Mit der erstmaligen Dokumentation von „tongue-nibbling“ bei wildlebenden Orcas liefert die Studie wichtige Impulse für die Verhaltensforschung mariner Säuger. Das Verhalten scheint sozial bindend zu wirken und ist offenbar über Generationen und geografische Populationen hinweg stabil. Die Beobachtung belegt, dass unter Wasser verborgene Interaktionen zentrale Bestandteile des Soziallebens sein können. Sie zeigt auch, wie wertvoll Unterwasserethologie und verantwortungsvoll eingesetzte Bürgerwissenschaft sein können – sofern sie ethisch vertretbar und methodisch fundiert eingebettet sind.