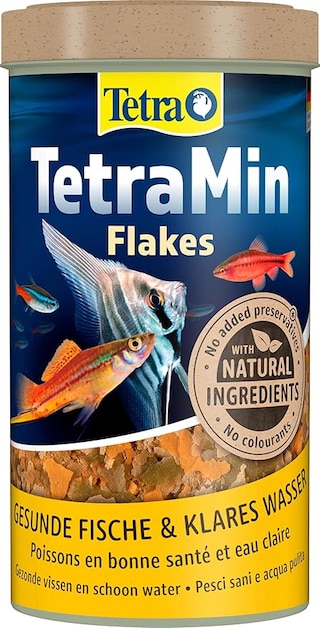9. Mai 2025, 17:36 Uhr | Lesezeit: 6 Minuten
Wie überleben Fische in den extremen Bedingungen der Tiefsee – bei eisiger Kälte, Dunkelheit und enormem Wasserdruck? Eine Genomstudie liefert überraschende Antworten: Ein einziges mutiertes Gen könnte tiefseeweite Wirkung haben. Außerdem zeigt sich: Spuren des Menschen finden sich sogar im tiefsten Graben des Meeres.
Der Mensch weiß mehr über den Mond als über die Tiefsee – und entsprechend auch wenig über die Tiere im Marianengraben, dem tiefsten Punkt der Erde. Das liegt nicht nur daran, dass der Weltraum lange Priorität genoss, sondern auch daran, dass die Erforschung dieses Extremraums nur mit Spezialtechnik möglich ist: In bis zu 11.000 Metern Tiefe herrschen 1070 bis 1100 bar Druck.
Wie viel das ist? Ein Afrikanischer Elefantenbulle wiegt rund 5000 Kilogramm. Steht er auf einem Quadratmeter, erzeugt er etwa 0,5 bar Druck. Um die Bedingungen im Marianengraben zu simulieren, bräuchte es also mindestens 2140 Elefanten pro Quadratmeter übereinandergestapelt.
Tiere im Marianengraben halten Druck von 2140 Elefanten aus
Die Tiefsee ist eines der extremen und am wenigsten erforschten Ökosysteme der Erde – mit enormem Druck, Kälte und Dunkelheit. Wann und wie Fische diesen Lebensraum eroberten, ist bis heute nicht vollständig geklärt. In der Fachliteratur kursieren drei grundlegende Hypothesen zur Besiedlung:
- dass die Tiefsee vor der Kreidezeit unbewohnt war,
- dass sie mehrfach neu besiedelt wurde sowie
- dass einige Fischgruppen sie als Rückzugsort bei Massenaussterben nutzten.
Die Forscher griffen in ihrer Untersuchung nun diese Modelle auf und analysieren mithilfe von Genomdaten die tatsächliche Besiedlungsgeschichte. Dabei zeigt sich: Einige Fischlinien – etwa aus der Familie der Aale – haben möglicherweise schon vor dem Kreide-Paläogen-Aussterben in der Tiefsee gelebt. Andere Gruppen, darunter die heutigen Hadal-Fische am Boden des Marianengrabens, tauchten erst später auf – parallel zur geologischen Entstehung der tiefen Risse in der Erdkruste.
Frühere Arbeiten deuteten ebenfalls darauf hin, dass die Konzentration von Trimethylaminoxid (TMAO), einem druckstabilisierenden Stoff, mit zunehmender Tiefe linear ansteigt – ein zentrales Dogma der Tiefseeforschung. Doch die nun erschienene Studie wirft auch an dieser Annahme Zweifel auf. Gleichzeitig stand die Frage im Fokus, welche genetischen Veränderungen es Fischen ermöglichen, bei bis zu 1100 bar Druck funktionsfähig zu bleiben.
Auffällige Mutation bei Tiefseefischen entdeckt
Ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Han Xu, Chengchi Fang und Shunping He (Chinesische Akademie der Wissenschaften) hat die Genome von Tiefseefischen entschlüsselt. Die Studie wurde im März 2025 in der Fachzeitschrift „Cell“ veröffentlicht. Alle untersuchten Arten stammen aus Tiefen von 1218 bis 7730 Metern – und leben auch im Marianengraben, dem tiefsten Punkt der Erde.
Die Studie basiert auf Genomanalysen von elf Tiefseebewohnern und einem Flachwasserfisch als Referenz. Die Proben wurden bei mehreren Expeditionen mit bemannten Tauchbooten aus Tiefen von bis zu 7730 Metern gesammelt. Es wurden vollständige Genome von Drachen-, Vipern-, Schnecken und Anglerfischen sequenziert. Anschließend wurden sie mit Genomdaten von 95 weiteren Fischarten verglichen.
Auch chemische Untersuchungen der Muskel- und Lebergewebe gaben Aufschluss über die Zusammensetzung von TMAO, Betaine, Fettsäuren, Schwermetallen und organischen Schadstoffen. Die Studie wurde nach ethischen Richtlinien durchgeführt und von mehreren staatlichen Förderprogrammen unterstützt.
Auch interessant: Die 7 gruseligsten Tiefseefische
Fische unterhalb von 3000 Metern wiesen Mutation auf
Die Forscher fanden eine Mutation, die in fast allen Fischarten unterhalb von 3000 Metern Tiefe auftrat. Dabei ist rtf1 ein zentraler Transkriptionsfaktor – also den Prozess, bei dem genetische Information in RNA umgeschrieben wird. Laborexperimente zeigten, dass diese Mutation auch die Transkriptionsrate in menschlichen Zellen verändert – vermutlich auch eine Anpassung an Druck und Kälte. Allerdings bei weitem nicht so extrem wie bei den Tiefseefischen.
Bemerkenswert war außerdem, dass die TMAO-Konzentration in Muskelgewebe nicht, wie bisher angenommen, linear mit der Tiefe anstieg. Fische in über 6000 Metern Tiefe wiesen teils geringere TMAO-Werte auf als Arten aus mittleren Tiefen. Dies widerlegt die lange akzeptierte Hypothese, dass TMAO allein den Tiefseedruck kompensiert.
„Die Tatsache, dass genau diese Mutation unabhängig neunmal in Knochenfisch-Linien unterhalb von 3000 m Tiefe aufgetreten ist, ist erstaunlich und deutet auf einen starken Selektionsvorteil unter Hochdruckbedingungen hin“, teilt Professor Wang, Seniorautor der Studie, PETBOOK auf Anfrage mit.
Umweltgifte schon am tiefsten Punkt des Meeres angekommen
Zusätzlich wurde ein hoher Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren (z. B. DHA, EPA) in Tiefseefischen nachgewiesen. In den Genomen zeigten sich zudem erweiterte Genfamilien für Antioxidations- und Membranbildungsprozesse. Erschreckend: In den Geweben aller untersuchten Tiere – selbst in der Hadalzone im Marianengraben – fanden sich langlebige Umweltgifte wie Polychlorierte Biphenyle (PCB) und Polybromierte Diphenylether (PBDE).
Bei PCB handelt es sich um Gruppen synthetischer chlorhaltiger Industriechemikalien, die früher in Kühlflüssigkeiten, Transformatoren, Farben und Dichtungsmassen verwendet wurden. PBDE wurden als Flammschutzmittel in Kunststoffen, Möbeln, Textilien und Elektronikprodukten eingesetzt.
In Deutschland ist der Ersatz seit den 1980er-Jahren verboten. Beide Gruppen von Stoffen sind sehr langlebig, fettlöslich und stark bioakkumulierend – reichern sich also in der Nahrungskette an. Zusätzlich sind sie schwer abbaubar und weltweit in Tiergeweben nachweisbar – selbst in der Arktis und nun auch der Tiefsee. Für Prof. Wang ein drastischer Hinweis darauf, wie allgegenwärtig menschliche Schadstoffe inzwischen sind.

Wie überleben Tiere in der Tiefsee?

Die 7 gruseligsten Tiefseefische

Studie zeigt, warum bei manchen Tieren die Evolution scheinbar stillsteht
Tiere im Marianengraben müssen besser verstanden werden
Die Studie liefert erstmals umfassende genetische Beweise dafür, dass Tiefseefische – unabhängig von ihrer Abstammung – über eine gemeinsame Mutation verfügen. Das spricht für konvergente Evolution. Ausgelöst durch Umweltfaktoren wie Druck und Temperatur. Diese Anpassung könnte entscheidend dafür sein, wie biologische Prozesse unter Extrembedingungen funktionieren. „Wir gehen fest davon aus, dass es weitere konvergente Anpassungen bei Hadal-Fischen gibt – sei es in Form struktureller Feinabstimmungen anderer Schlüsselproteine oder durch Veränderungen in Transkriptions- oder Signalnetzwerken“, teilt Prof. Wang PETBOOK weiter mit.
Damit liefert die Studie zentrale Impulse für die Tiefseebiologie und zeigt, wie molekulare Anpassungen neue Evolutionspfade öffnen. Grundsätzlich verändert sie auch das bisherige Verständnis von TMAO als Hauptfaktor der Druckanpassung. Gleichzeitig belegt dies eine genetisch fundierte Zeitleiste zur Tiefseebesiedlung durch Fische – und zeigt, dass sich die Anpassung an extreme Tiefe mehrfach unabhängig entwickelte.
„Derzeit beruhen unsere Erkenntnisse hauptsächlich auf genomischen Daten: Wir können evolutionäre Signale in der DNA erkennen und mögliche Anpassungsmechanismen oder Verhaltensänderungen ableiten – aber es fehlt uns an direkten Beobachtungen vor Ort“, sagt Prof. Wang PETBOOK weiter.
Die Forscher wüssten aber nicht, wie groß diese Populationen wirklich sind, welche Arten ausschließlich im Graben leben und welche nur temporäre Besucher sind, wie sie wandern oder Tiefsee-Barrieren überwinden – oder welche Umweltfaktoren die entscheidenden Treiber für eine Besiedlung des Grabens sind.
„Um diese Fragen zu beantworten, braucht es langfristige Beobachtungen mit autonomen oder ferngesteuerten Tiefsee-Fahrzeugen, erweiterte eDNA-Analysen und detaillierte molekular-zelluläre Experimente im Labor.“
Und: Selbst am tiefsten Punkt der Erde ist der Mensch präsent – in Form toxischer Rückstände. Weitere Studien müssen nun klären, ob es ökologische Konsequenzen der Schadstoffbelastung dieses einzigartigen Lebensraums gibt – und wie man ihn besser schützen kann. 1