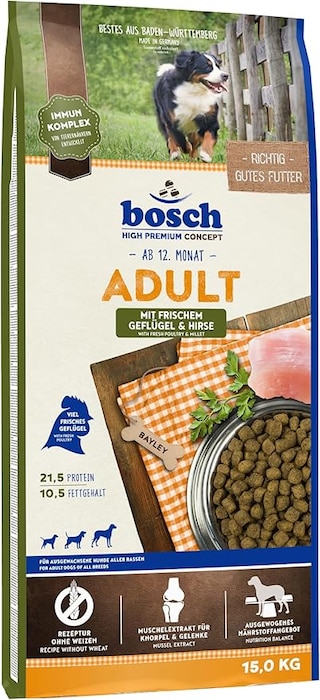27. Mai 2025, 11:39 Uhr | Lesezeit: 5 Minuten
Immer mehr Menschen betrachten ihren Hund nicht nur als Haustier, sondern als ein echtes Familienmitglied – oder gar als Kinderersatz. Inmitten sinkender Geburtenraten und wachsender Urbanisierung übernehmen Hunde zunehmend emotionale Rollen, die einst menschlichen Kindern vorbehalten waren. Doch was macht den Hund zum perfekten „Ersatzkind“ – und wo liegt die Grenze? Eine Studie beleuchtet das Phänomen „Dog Parenting“ in all seinen Facetten.
Während es früher häufig hieß: „Das letzte Kind hat Fell“, dreht sich dieser Trend immer mehr zu: „Das einzige Kind hat Fell!“ Weltweit sinken Geburtenraten, während Haustierhaltung stark zunimmt – vor allem in westlichen und ostasiatischen Großstädten. In vielen dieser Gesellschaften ist der traditionelle Familienbegriff im Wandel. Die Idee vom „Dog Parenting“ gewinnt daher nicht nur an Popularität, sondern verändert auch unsere Vorstellung von Familie, Bindung und Verantwortung.
Gleichzeitig übernehmen Haustiere zunehmend emotionale Funktionen. Während Kinder immer seltener Teil des Alltags sind, bieten Hunde eine alternative Möglichkeit zur Bindung und Fürsorge. Laut einer Studie basiert dieser Wandel weniger auf biologischer als auf kultureller Evolution: Menschen passen ihr fürsorgliches Verhalten neuen Umständen an, und Hunde bieten eine ideale Projektionsfläche für elterliche Bedürfnisse.
„Dog Parenting“ definiert soziale Rolle von Hunden neu
Laura Gillet und Enikő Kubinyi vom Department für Ethologie der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest haben sich schon häufiger mit allem, was Hunde betrifft, wissenschaftlich auseinandergesetzt. Gillet zum Beispiel stellte fest, dass es drei unterschiedliche Typen von Hundehaltern gibt, darunter eben auch „Hundeeltern“ (PETBOOK berichtete). Kubinyi zeigte unter anderem mit ihren „Senior Family Dog Projects“, welche Faktoren in der Haltung die Lebensdauer von Hunden beeinflussen kann und stellt die gute Bindung zu den Tieren in den Vordergrund (wie PETBOOK ebenfalls berichtete).
In ihrer jetzigen Untersuchung widmen sich die Forscherinnen einer großen Studenübersicht über die zunehmend Kind-ähnliche Rolle von Hunden. Dies betrifft vor allem westliche und einige asiatische Gesellschaften. Der Artikel erschien im Mai 2025 in der Fachzeitschrift „European Psychologist“.
Im Zentrum steht die Frage, warum Hunde heute in vielen Familien nicht nur als Tiere, sondern als emotionale Bezugspersonen und Kinderersatz gelten. Die Autorinnen analysieren morphologische, kognitive, verhaltensbiologische und soziokulturelle Parallelen zwischen Hunden und Kindern – und beleuchten ebenso kritisch die damit verbundenen Risiken für Mensch und Tier.
Gleicht Hundehaltung der Kindererziehung?
Die Autorinnen analysieren die bestehende wissenschaftliche Literatur aus Ethologie, Evolutionspsychologie und Soziologie. Ziel war es, die Parallelen zwischen Hundehaltung und Kindererziehung zu analysieren – von der Bindungstheorie in der Hundeerziehung bis hin zu kognitiven Fähigkeiten, Kommunikation und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Dabei berücksichtigten sie auch kulturelle Unterschiede und potenzielle Risiken übertriebener Vermenschlichung. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf Gesellschaften gelegt, in denen sich dieser Trend bereits gut beobachten lässt.
Die Übersichtsarbeit belegt umfassend, dass Hunde in vielerlei Hinsicht Kind-ähnliche Merkmale aufweisen – physisch, emotional und sozial. Sie zeigen sichere oder unsichere Bindungen zu ihren Besitzern, ähnlich wie Kinder zu Eltern. Denn wie Studien bereits zuvor zeigten, reagieren Hunde auf Trennungen mit Stress. In der Gegenwart ihrer Bezugspersonen zeigen sie jedoch mehr Selbstvertrauen – ein sogenannter „Sichere-Basis“-Effekt.
Auch das Sprechverhalten (höhere Stimmlage, Wiederholungen) ähnelt dem gegenüber Babys, wie weitere Forscher der Budapester Universität bereits 2024 zeigten. Mehr dazu können Sie hier nachlesen: Menschen sprechen „Baby-Sprache“ mit Hunden! Wie die Tiere darauf reagieren.
Darüber hinaus erreichen Hunde auch kognitiv Leistungen, die mit Kindern zwischen 1 und 2,5 Jahren vergleichbar sind. Dies gilt etwa beim Erkennen von Mimik, Imitation oder sozialem Lernen. Morphologisch dagegen fanden die Forscherinnen, dass besonders ihre großen Augen und runden Gesichter – besonders bei brachyzephalen Rassen wie Möpsen – ähnliche Fürsorgereaktionen wie Babygesichter auslösen. Gleichzeitig zeigen viele Hunde kind-ähnliches Verhalten wie Anhänglichkeit, Spieltrieb, Hilflosigkeit oder emotionale Abhängigkeit. Dies wiederum fördert das elterliche Verhalten ihrer Halter.

Besser als Freund oder Kind? Studie zeigt, wie gut die Mensch-Hund-Beziehung ist

Wissenschaftler definieren drei Arten von Hundebesitzern – welcher sind Sie?

Neue Studie identifiziert größte Vor- und Nachteile der Hundehaltung
„Dog Parenting“ – ein Trend, gekommen um zu bleiben?
Die Erkenntnisse der Studienleiterinnen zeigen aber auch, dass das Konzept des „Dog Parenting“ mehr ist als nur ein modischer Trend. Es spiegelt tief verwurzelte menschliche Bedürfnisse wider: Fürsorge, Nähe, Verantwortung – auch über Artgrenzen hinweg. Besonders in individualisierten Gesellschaften mit kleiner werdenden Familienstrukturen übernehmen Hunde eine soziale und emotionale Ersatzfunktion. Die Analogie zur Elternschaft manifestiert sich nicht nur im Verhalten, sondern auch in hormonellen Reaktionen (z. B. Oxytocin-Ausschüttung), Alltagsroutinen und Rollenbildern.
Trotzdem zeigen die Autorinnen auch auf: Die Beziehung Hund–Mensch ist einzigartig und nicht völlig identisch mit der zu einem Kind. Hunde bleiben ein Leben lang abhängig, werden nicht autonom – und das Machtgefälle ist deutlich stärker. Allerdings kann die Bindung zum Hund dadurch sogar stärker als zu einem Kind werden. Die Ergebnisse fördern ein besseres Verständnis für die Vielfalt moderner Bindungsformen zwischen Mensch und Tier. Gleichzeitig regen sie zum Umdenken in Bezug auf Tierwohl und Familienkonzepte an.
Die Arbeit liefert einen systematischen, differenzierten und gut dokumentierten Überblick über den aktuellen Forschungsstand. Einschränkungen ergeben sich durch die Fokussierung auf bestimmte Gesellschaften; andere Kulturräume bleiben (noch) außen vor.
Auch bleibt unklar, inwieweit die beschriebenen Effekte generalisierbar sind – etwa auf Halter anderer Haustierarten oder auf Menschen mit abweichender Bindungserfahrung. Ein weiteres Problem ist die potenzielle Verzerrung durch stark vermenschlichende Halterperspektiven in einigen Studien, die nicht immer im Interesse des Tierwohls stehen. Darunter fällt auch die Präferenz für krankgezüchtete Hunde mit kurzen Köpfen, die in einigen Arbeiten identifiziert wurde. 1