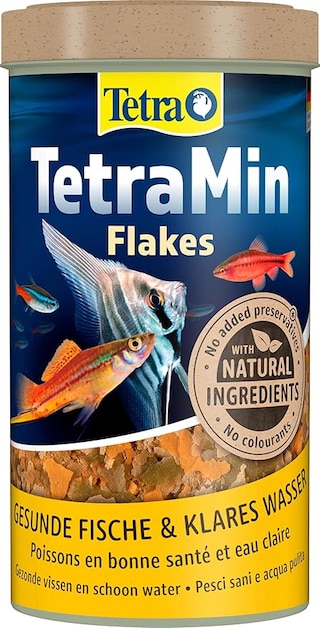21. Mai 2025, 17:42 Uhr | Lesezeit: 13 Minuten
Wer nicht gerade an der Küste Deutschlands wohnt oder eine Klassenreise dahin unternommen hat, stellt sich das Watt wohl vor allem wie eine durchweichte Einöde mit ein paar glitschigen Würmern vor. Allerdings handelt es sich dabei um einen der faszinierendsten Lebensräume, den man in Deutschland erleben kann. Warum sich eine Wattwanderung unbedingt lohnt und wo die vielen Bewohner der seichten Landschaft eigentlich hingehen, wenn die Flut kommt, hat PETBOOK-Redakteurin Louisa Stoeffler für Sie zusammengetragen.
Ich bin ehrlich: Als ich in der achten Klasse mit der Schule an die Nordsee gefahren bin, war ich von der obligatorischen Wattwanderung alles andere als begeistert. Ich kannte vorher vor allem die Ostsee, war dort fast jedes Jahr in den Ferien. Von der Nordsee wusste ich nur, dass sie kälter und weiter weg war. Auch die Tatsache, dass wir Ende September bei Wind und Regen frühmorgens mit nackten Füßen (keiner hatte Gummistiefel) durch eiskalten Sand stampften, trug nicht dazu bei, die Erfahrung irgendwie zu verschönern. Erst viel später lernte ich das Wattenmeer und die dort lebenden Tiere zu schätzen. Mit 13 war ich sogar zu durchgefroren und schlecht gelaunt, um mir die für mich heute spannendste Frage von allen zu stellen: Wohin gehen die Tiere eigentlich, wenn die Flut wiederkommt?
Ein einzigartiger Lebensraum – ständig in Bewegung
Wenn man das Wattenmeer nicht gerade während einer Beschäftigungsmaßnahme für zunehmend grummelige Teenager erlebt, kann man (mit wärmender Funktionskleidung) einen faszinierenden Einblick in das Zusammenspiel von Arten erhalten. Auch wenn das Wattenmeer den ersten Blick bei Ebbe wie eine trostlose, matschige Fläche wirkt, leben hier laut der Website des Nationalparks Wattenmeer bis zu 10.000 verschiedene Arten!
Wer also genauer hinschaut – oder einen Spaten vorsichtig in den Schlick steckt – entdeckt: Hier wimmelt es von Leben. Wattwurm, Herzmuschel, Strandkrabbe? Ja, die kennt man vielleicht. Aber im Wattenmeer leben noch viele weitere, teils überraschende Tiere – und alle haben sie sich perfekt an das ewige Spiel der Gezeiten angepasst.
Das Wattenmeer erstreckt sich entlang der Nordseeküste von den Niederlanden über Deutschland bis nach Dänemark – und ist UNESCO-Weltnaturerbe. Drei Nationalparks und drei Biosphärenreservate allein in Deutschland stellen einen der größten zusammenhängenden Naturschutzräume hierzulande dar. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es einen vergleichbaren Gezeitenraum dieser Größe. Zweimal täglich fällt das Land trocken, zweimal täglich kehrt das Wasser zurück. Diese ständige Veränderung macht das Watt zu einem extrem dynamischen Ökosystem, das an seine Bewohner besondere Anforderungen stellt – aber ihnen gleichzeitig auch enorme Chancen bietet: Nahrung im Überfluss, Schutz vor Fressfeinden und ideale Brutbedingungen. Genau deshalb ist das Wattenmeer auch ein Hotspot für Zugvögel und Jungtiere.
11 Tiere, die im Watt leben – und faszinieren
Natürlich können wir in diesem Artikel nicht alle 10.000 Arten, die bereits im Watt beobachtet wurden, vorstellen. Deswegen beschränken wir uns hier auf Tiere, die entweder besonders überraschen oder eigentlich altbekannt sind, obwohl viele doch sehr wenig über sie wissen.
1. Wattwurm (Arenicola marina)
Beginnen wir mit dem Klassiker schlechthin im Schlick: dem Wattwurm, auch (Sand-)Pierwurm oder Prielwurm genannt. Es ist wohl das bekannteste Tier des Wattenmeeres – obwohl man ihn fast nie sieht. Der Wattwurm lebt versteckt in u-förmigen Röhren im Boden und frisst sich durch den Sand. Dabei filtert er organische Reste heraus – und scheidet den Sand in kleinen Würstchen auf der Oberfläche wieder aus. Diese „Wattwurmhäufchen“ sind ein typisches Zeichen dafür, dass hier unten jemand fleißig arbeitet. Ein einziger Quadratmeter Wattboden kann bis zu 50 dieser Würmer beherbergen – ein gigantischer natürlicher Biofilter.
2. Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Mit ihren scharfen Scheren und dem gepanzerten Körper ist die Gemeine Strandkrabbe perfekt an das Leben im Wechselspiel von Wasser und Trockenheit angepasst. Sie ist ein wahrer Überlebenskünstler, der bei Ebbe in Pfützen ausharrt oder sich in den Boden eingräbt, um nicht zu überhitzen. Ihre Nahrung ist vielseitig: Muscheln, Würmer, kleinere Krebse oder Aas – was immer sie erwischt. Als invasiver Generalist hat sie sich inzwischen sogar weltweit ausgebreitet, stammt aber ursprünglich aus dem Nordseeraum.
3. Herzmuschel (Cerastoderma edule)
Auf den ersten Blick unscheinbar, gehört die Gemeine oder Essbare Herzmuschel zu den wichtigsten Filtrierern im Watt – sie sorgt also für die Sauberkeit des Wassers und ist wichtige Nahrungsgrundlage für andere Tiere. Dafür besitzt sie zwei Siphons, mit denen sie Wasser einsaugt und nach Plankton durchsiebt.
Ähnlich besonders ist ihre Vermehrungsweise. Dabei geben weibliche und männliche Muscheln ihre Eier und Spermatozoen einfach ins Wasser und dann wird gehofft, dass beide zusammenkommen. Bis zu 50.000 Eier produziert eine Muschel pro Brutperiode!
Im Watt versteckt sie sich meist im fünf bis zehn Zentimeter tiefen Sand. Wird sie ausgebuddelt, kann sie sich mit ihrem Fuß binnen weniger Minuten schnell wieder vergraben – wirklich faszinierend zu beobachten! Bei Ebbe zeigt sie noch eine weitere Anpassung: Dann schließen sich ihre beiden Schalenhälften blitzschnell, um nicht auszutrocknen. Wenn die Flut zurückkommt, ist sie sofort wieder aktiv – ein kleiner Kraftprotz mit großer ökologischer Wirkung.
4. Wattschnecke (Hydrobia ulvae)
Sie ist winzig – oft kaum drei Millimeter groß – aber in gigantischer Anzahl vertreten. Die Gemeine Wattschnecke lebt in dichten Populationen auf dem Schlick und frisst mit ihrer Raspelzunge sogenannte Mikroalgen, die sich in einer feinen, grünen Schicht auf dem Boden ansiedeln. Damit erfüllt auch sie eine wichtige Reinigungsfunktion im Ökosystem, die zwar besonders clever, aber auch etwas eklig ist. Denn bei Ebbe und Flut haben die cleveren Weichtiere unterschiedliche Strategien entwickelt – und beide drehen sich um Schleim, der essenziell für den Erhalt des Ökosystems ist.
Läuft die Flut aus, heften sie sich mit dem Fuß nach oben an die Wasseroberfläche, wobei ein Schleimband entsteht. An diesem bleibt ihre Nahrung kleben, die dann gemütlich eingesaugt wird. Bei beginnender Ebbe wird sich dann fallen gelassen und auf den Sand gesetzt. Auch hier bilden die Schnecken einen Schleimfilm, um im Sand nach Essbarem zu suchen. Dabei sind meist so viele Schnecken unterwegs, dass wahre Schleimseen im Watt entstehen. Das Besondere: Bei der Flut wird so viel weniger Sand abgetragen und es sorgt dafür, dass sich neuer Sand ablagert, indem er einfach am Schneckenschleim fest pappt.
Hat sie ausreichend Schleim produziert, geht die Wattschnecke dann in den Ruhemodus und gräbt sich im Sand ein, um Feuchtigkeit zu sparen. Und wenn sie doch mal trockenfällt? Kein Problem: Sie kann wochenlang ohne Wasser auskommen, indem sie sich in ihr Gehäuse zurückzieht.
5. Schillernder Seeringelwurm (Hediste diversicolor)
Dieser bunte Vielborster mit seinen kleinen Beinchen und dem segmentierten Körper ist ein echtes Raubtier unter den Wattwürmern. Allerdings ist er nichts gegen den längsten fleischfressenden Wurm der Welt Lineus longissimus. Mehr über dieses besondere Tier erfahren Sie hier: Dieser 55 Meter lange, fleischfressende Megawurm lebt in der Nordsee.
Mit seinen kräftigen Kieferzangen greift der Seeringelwurm aktiv nach Beute wie Kleinkrebsen oder Muschellarven. Gleichzeitig ist er selbst Beute für viele Wattvögel und damit ein wichtiges Bindeglied in der Nahrungskette. Seine Farbe variiert von grünlich bis rötlich – je nachdem, wie viel Hämoglobin er im Blut hat. Je mehr davon, desto besser kommt er mit Sauerstoffmangel im Boden klar.
6. Sandklaffmuschel (Mya arenaria) und Abgestutze Klaffmuschel (Mya truncata)
Hierbei handelt es sich um Tiere, die man bei einem Wattspaziergang wohl nicht sehen wird. Beide Muscheln sind eigentlich in der Nordsee auch nicht heimisch. Die Sandklaffmuschel ist eher in den Gewässern Nordamerikas verbreitet, die Abgestutzte Klaffmuschel eher in arktischen Gewässern. Beide eingewanderten Arten finden sich jedoch auch im Watt und haben sich, im Gegensatz zu vielen anderen, gut in das heimische Ökosystem eingefügt.
Anders als die Herzmuschel vergräbt sich die Sandklaffmuschel besonders tief – bis zu 50 Zentimeter unter die Oberfläche, man müsste also schon ordentlich buddeln, um sie zu entdeckten. Die Abgestutzte Klaffmuschel lebt noch weiter unten, in etwa 70 Metern Tiefe. Von dort aus strecken sie zwei lange Siphons nach oben, mit denen sie Wasser ansaugen und filtriert. Ihre Schalen sind vergleichsweise dünn, weshalb sie in der Tiefe sicherer vor Fressfeinden sind. Bei Ebbe bleiben sie im Boden verborgen – stille Giganten unter den Muscheln im Wattenmeer.
7. Nordseegarnele (Crangon crangon)
Die Nordseegarnele ist ein weiteres Tier, das wahrscheinlich viele mit dem Lebensraum Wattenmeer verbinden. Dies merkt man auch schon an den unzähligen Namen, die das Tier trägt. Wechselweise als Sand- oder Strandgarnele, Graue Krabbe, Porren oder in der Küche einfach „Krabbe“ genannt. Sie ist nicht nur ein Klassiker auf norddeutschen Tellern, sondern auch selbst ein echter Jäger. Mit ihren langen Fühlern und schnellen Reflexen jagt sie kleine Fische, Würmer und Plankton.
Sie ist meist nachtaktiv und folgt bei Flut den Wellen ins flachere Wasser, um dort auf Beutefang zu gehen. Dabei zieht sie sich auch gern in Flussmündungen zurück, wo sie vor allen Fressfeinden – außer dem Menschen – sicher ist. Denn der veränderte Salzgehalt macht ihr nichts aus, ist für viele Fische, die sie gern verspeisen wollen würden, aber ein Hindernis. Ihre Tarnfarbe – meist grau oder bräunlich – passt sich dem Untergrund an und schützt sie zusätzlich vor Beutegreifern.
8. Austernfischer (Haematopus ostralegus)
Kaum ein Vogel steht so sinnbildlich für das Wattenmeer wie der Austernfischer – mit seinem schwarz-weißen Gefieder, den rosa Beinen und dem auffällig roten Schnabel wird er manchmal auch scherzhaft Halligstorch genannt.
Der Schnabel ist aber auch ein präzises Werkzeug: Er dient dazu, ihre Beute aufzuknacken oder ihre Schalen auseinanderzudrücken. Anders, als sein Name vermuten lässt, besteht diese aber kaum aus Austern, die in der Nordsee heimische Europäische Auster ist fast restlos verschwunden. Stattdessen hat sich dort die Pazifische Auster als invasive Art ausgebreitet.
Von denen ernährt sich der Austernfischer nicht, sondern hat sich auf Herz- und Miesmuscheln spezialisiert. Er frisst aber auch Schnecken und Würmer. Austernfischer sind monogam, lautstark und äußerst standorttreu – und sie brüten oft direkt auf den offenen Wattflächen oder Salzwiesen.
9. Rotschenkel (Tringa totanus) und Grünschenkel (Tringa nebularia)
Nein, die beiden Vögel stellen keine Ampelsignale im Watt dar. Tatsächlich sehen die eleganten Vertreter der Schnepfenvögel auch weniger unscheinbar aus, als ihre Namen vermuten ließen. Lediglich ihre staksigen Beine, mit denen sie bei Ebbe auf Futtersuche das Watt durchwaten, geben ihnen ihre Namen. Der Grünschenkel ist vor allem an der niederländischen Nordsee verbreitet, findet sich aber auch in Deutschland.
Beide Tiere durchstochern das Watt mit dem spitzen Schnabel auf der Suche nach Würmern, Krebstieren und Insektenlarven. Spannend zu beobachten ist auch, dass sie im Binnenland als tagaktive Vögel gelten – an der Küste ihre Aktivitätsphasen aber genau auf Ebbe und Flut abgestimmt haben. Ihre Rufe – ein helles, durchdringendes „tü-tü-tü“ – hört man oft schon von Weitem. Besonders der Rotschenkel ist außerdem ein Warnrufgeber für andere watenden Vögel: Wenn er auffliegt, fliegen viele mit.
10. Seehund (Phoca vitulina) und Kegelrobbe (Halichoerus grypus)
Der Seehund ist das bekannteste Säugetier im Wattenmeer – und gleichzeitig ein echter Sympathieträger. Mit seinen großen, dunklen Augen, dem rundlichen Kopf und dem sanften Gesichtsausdruck wirkt er fast niedlich. Er lebt in größeren Gruppen und ruht sich bei Ebbe auf Sandbänken aus. Bei Flut geht er auf Fischjagd – bevorzugt Heringe, Sandaale und Grundeln. Seehunde sind äußerst anpassungsfähig und gute Taucher, die mehrere Minuten unter Wasser bleiben können.
Doch seit einigen Jahrzehnten kehrt ein weiterer Meeressäuger ins Wattenmeer zurück: die Kegelrobbe. Lange Zeit war sie in deutschen Gewässern fast ausgestorben – durch Jagd, Umweltgifte und Störungen in ihrem Habitat. Doch mittlerweile erholt sich der Bestand wieder, vor allem rund um Helgoland, die Ostfriesischen Inseln und einige Halligen. Und sie ist kaum zu übersehen: Die Kegelrobbe ist deutlich größer und massiger als der Seehund, vor allem die Männchen. Wie man die beiden unterscheidet:
Seehund
- Kopfform: rundlich, kurzes Gesicht
- Nasenlöcher: v-förmig
- Große und Gewicht: 1,8 Meter und ca. 100 kg
- Vorkommen: Häufig im gesamten Wattenmeer
- Brutzeit (und häufigste Sichtungszeit): Juni/Juli
Kegelrobbe
- Kopfform: langgezogen, „hundeschnauzig“
- Nasenlöcher: parallel, gerade verlaufend
- Große und Gewicht: 2,5 Meter und ca. 300 kg
- Vorkommen: selten, vor allem um Inseln verbreitet
- Brutzeit (und häufigste Sichtungszeit): Dezember/Januar
Beide Robbenarten sind streng geschützt und auf ungestörte Rückzugsorte angewiesen – besonders in der Wurf- und Aufzuchtzeit. Wer sie beobachten möchte, sollte unbedingt Abstand halten und sich an markierte Ruhezonen halten. Wattführungen, Nationalpark-Häuser oder spezielle Seehundstationen (z. B. in Friedrichskoog oder Norden-Norddeich) bieten gute Möglichkeiten zur Information und tierfreundlichen Beobachtung.
11. Scholle (Pleuronectes platessa), Hering (Clupea harengus) und Seezunge (Solea solea)
Ja, auch verschiedene Fische finden sich im Watt. Die Scholle ist einer der bekanntesten Plattfische der Nordsee – und nutzt das Watt ganz gezielt als Aufzuchtgebiet. Nach dem Schlüpfen treiben die Larven mit der Strömung ins Flache, wo sie in den warmen Gewässern schneller wachsen können. Spannend: Während der Metamorphose wandert ein Auge von der einen auf die andere Körperseite – und die Scholle wird sozusagen erst zum Plattfisch, der seitlich auf dem Boden lebt. Hier lauert sie gut getarnt im Schlick auf kleine Würmer und Krebstiere. Erst als ausgewachsene Tiere ziehen Schollen in tiefere Nordseegebiete weiter.
Die Seezunge gilt als Delikatesse – doch bevor sie vielen auf den Teller kommt, lebt sie ein gut getarntes Leben auf dem Meeresboden. Wie die Scholle ist auch die Seezunge ein Plattfisch, der sich bevorzugt in sandigen und schlammigen Zonen aufhält. Jungtiere wachsen oft ebenfalls im Wattenmeer auf, weil es hier reichlich Nahrung in Form von Würmern und kleinen Muscheln gibt. Anders als viele andere Fische bleibt die Seezunge auch als erwachsenes Tier in Küstennähe – sie ist nachtaktiv und nutzt die Flut, um weiter ins Watt vorzudringen.
Der Hering dagegen ist eigentlich ein typischer Hochseefisch – doch zweimal im Jahr kommen große Heringsschwärme in die Nähe des Watts: Im Frühjahr und Herbst schwärmen sie zur Nahrungssuche und Fortpflanzung in küstennahe Bereiche. Ihre Larven und Jungfische nutzen flache, nährstoffreiche Wattzonen als Zwischenstation auf dem Weg ins offene Meer. Seehunde und größere Fische folgen ihnen – und machen Jagd auf die silbrigen Schwärme, die sich durch das Lichtspiel oft gut orten lassen.

Immer mehr Robben sterben am Plastikmüll im Meer

Sind Stachelrochen für Menschen gefährlich?

Gibt es einen Unterschied zwischen Sardine und Sardelle?
Und wohin verschwinden die Tiere im Wattenmeer, wenn die Flut kommt?
Diese 11 Beispiele sind typisch für das Ökosystem Watt. Bliebe aber noch die Frage zu klären, wohin all diese Arten verschwinden, wenn das Wasser zurückkehrt. Denn dann ändern sich die Lebensbedingungen schlagartig – allerdings sind die Tiere im Watt darauf gut vorbereitet:
- Wattwürmer, Muscheln und Schnecken bleiben einfach im Boden, denn sie leben sowieso vor allem eingegraben.
- Krabben, Garnelen und Fische folgen der Flut in tieferes Wasser, wo sie aktiver jagen können.
- Vögel ziehen sich aufs Festland oder auf höher gelegene Sandbänke zurück.
- Doch Seehunde und Kegelrobben nutzen die Gelegenheit, um auf Fischjagd zu gehen – mit erstaunlicher Effizienz.
Heute, nachdem ich mich mehr mit den Tieren im Watt und den faszinierenden Zusammenhängen im Ökosystem auseinandergesetzt habe, sehe ich diesen Lebensraum mit ganz anderen Augen und würde ihn gern noch einmal erleben. Etwas voreingenommen, gerade weil ich seit Längerem eine besondere Faszination für Weichtiere entwickelt habe, aber daher auch mit viel mehr Verständnis. Denn das Wattenmeer lebt im Rhythmus der Gezeiten – und genau das macht es so besonders.